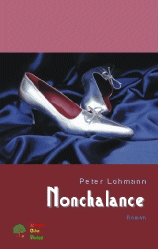 Nonchalance von Peter Lohmann
Nonchalance von Peter LohmannMünchen. Die Hotels. Während die achtzehnjährige Stutzi in einer Nobelherberge arbeitet, serviert ihr Bruder Rolf in einem Hotel am Hauptbahnhof den Dealern, Kriminellen und Prostituierten
Der Autor
Peter Lohmann wurde 1941 in Innsbruck geboren. Als Kellner lernte er die Welt kennen, als Hotelier die Menschen. Aus diesem Milieu stammen seine Personen, seine Geschichten. Während seiner Lehrzeit als Kellner schrieb er Wild-West Geschichten, um sein Einkommen aufzubessern. Heute, nach vierzig Jahren, Lebt er zusammen mit seiner Frau auf einem Weingut in der Steiermark und schreibt Romane.
1.
Die Gäste an der Bar drehen sich um, an den Tischen sitzt man mit Blick zur Tanzfläche.
Mandy hat ihren Auftritt.
Charly, unser Chef, hatte mal wieder den richtigen Riecher. Er hat Mandy von der Straße geholt, vom Straßenstrich, und ein gutes Geschäft damit gemacht. Nicht, dass sie besonders gut singen oder tanzen könnte, wirklich nicht, aber sie kann sich bewegen. Und wie!
Sie steckt in einem tomatenroten Wollkleid, hochgeschlossen, und alles an ihr ist gleitend, fließend, ähnlich einer Coca-Cola-Flasche. Keine Boa, keine Handschuhe oder sonstiger Firlefanz, den andere Stripperinnen brauchen: ihr Kleid, ein Barhocker und raffiniertes Licht sind ihre einzigen Utensilien. Ohne Eile, aber auch ohne zeitraubende Gesten, schält sie sich aus dem Kleid. Ein langer Reißverschluss teilt es von oben bis unten. Und dann legt Mandy los. Laszive Bewegungen, ordinär angedeutete Gestik: Sie weiß genau, wie sie die Phantasie ihres Publikums weckt! Nicht nur bei den Herren steigen Blutdruck und Atemfrequenz, auch die Damen kriegen große Augen und feine Schweißperlen um die Nase.
Dabei ist Mandy eine umgängliche Person. Wir unterhalten uns ab uns zu. Vor der Show trinkt sie immer ein Glas Champagner, sonst nur Mineralwasser. Ihr Lächeln, wenn sie mir zutrinkt, könnte ich als Einladung auffassen. Doch ich habe regelrecht Angst vor einer Frau, die solche Bewegungen drauf hat.
Ihre Maße von 85, 55, 85 stimmen auch. Ich habe nicht nachgemessen, sondern weiß es von Stutzi, meiner Schwester, die auch in diesem Laden arbeitet und Mandy manchmal ein Getränk in die Garderobe bringt. Stutzi und ich sind ein gutes Team, sie vor, ich hinter dem Tresen.
„Los, Brüderchen, meine Gäste sind hitzig und wollen löschen: Zwei Highball, drei Gin-Fizz, drei Champagner-Cocktail, eine halbe Moet“, lautet ihr Part.
Während ich mixe, ist Stutzi schon wieder weg, neue Bestellungen aufnehmen.
Lauter Beifall bricht los, als Mandy noch einmal ihre rasierte und kreideweiß gepuderte Muschi bewegt und mit dem Hintern wackelt, dessen Falte mit Schminke bis ins Kreuz verlängert ist. Die Stripperin kriegt Standing Ovations.
Um halb fünf schlüpfen Stutzi und ich in unsere Mäntel. Die Kragen hochgeschlagen, lehnen wir uns müde gegen Wind und Regen. Aggressiv klatschen mir die Tropfen ins Gesicht, als hätten sie es alleine auf mich abgesehen.
Endlich sitzen wir im Taxi. Stutzi lehnt sich an mich und schläft gleich ein. Die Fahrt dauert eine halbe Stunde. Wir wohnen etwas außerhalb. Brummer zuliebe.
Als wir aus dem Wagen klettern und ins Haus stolpern, schießt ein schwarzes Ungetüm mit quietschendem Gejaule auf uns. Brummer, unser dritter im Bunde. Brummer zelebriert die Begrüßung immer mit ungestümer Zärtlichkeit.
Was ein Neufundländer ist, weiß man ja.
Was ein Neufundländer sein kann, wissen nur Stutzi und ich. Wer kann schonbegreif en, wie eng die Freundschaft mit diesem siebzig Kilo schweren Koloss sein kann, mit welch bedingungsloser Hingabe dieser zottige, bullige Hund an meiner Schwester hängt und mit welch souveräner Überlegenheit er meine Existenz duldet. Brummer gehört Stutzi und sie gehört ihm, und wehe dem, der daran zweifelt! Dieser schwarze Satan mit der hellroten Zunge beißt mit einem Schnapper ein solides Holzscheit durch , rennt Türen ein und wirft jeden Mann über den Haufen, wenn’s sein muss.
Meine Schwester kniet auf der nassen Erde, krault zärtlich in seinem Fell.
„Dummer Kerl , wirst ja pitschnass. Ab schnell ins Haus.“
Lautlos schleichen wir die Treppe hoch. Stutzi drückt mir in der Wohnung ihre Tasche, den Mantel und Schal in die Hand und wankt ins Bad. Sie ist todmüde. Für einen Augenblick tut sie mir leid.
Nach einer halben Stunde sehe ich nach ihr. Sie sitzt noch immer in der Wanne. Der Schaum hat sich schon aufgelöste. Ich tippe ihr auf die Schulter: „Schlaf nicht ein, das Wasser wird kalt.“
Sie dreht den Kopf und nickt. Wenig später höre ich sie kommen. In ihrem weiten Pyjama sieht si e noch kleiner, noch zerbrechlicher aus. Mit geschlossenen Augen schleicht sie zu ihrem Bett, richtet das Kopfkissen und krabbelt unter die Decke.
Ich zünde eine Zigarette an, stecke sie zwischen ihre Lippen; Sie nimmt einen Zug und morst mit den Augenlidern noch schnell: Gute Nacht.
Nun ist es ganz still. Auch draußen rührt sich noch nichts. Am Fenster neben mir blähen sich die Vorhänge, der Wind fängt sich in ihnen. Feiner Wasserstaub legt sich auf mein Gesicht. Es ist sechs Uhr früh. Ich tippe auf den Knopf der Nachtischlampe, die auf einem Tischchen steht, das zwischen Stutzis und meinem Bett eingeklemmt ist.
Jetzt spüre ich erst, wie weh mir die Knochen tun. Jeden einzelnen spüre ich. Das verdammte Wetter muss daran schuld sein. Mitte Mai, und Stutzi trägt ihren dicken Lodenmantel und ich meine Felljacke. Seit Tagen fällt nasskaltes Wasser vom Himmel, und je mehr wir auf Besserung hoffen desto kälter wird der Regen. Stutzi bockt schon seit ein paar Tagen. Das kann sie verdammt gut.
Überhaupt: Stutzi! Bald wird sie neunzehn. Eigentlich heißt sie Amanda, die Liebenswerte, aber so recht hat sie sich nie mit ihrem angetauften Namen abgefunden. Tante Agathe, die Urheberin dieser Geschmacklosigkeit, bekam Stielaugen, als Stutzi ihr vor vielen Jahren die unverblümte Meinung sagte. Damals lebte unser Vater noch. Er lachte schallend und rieb sich vergnügt die Hände, als
Tante Agathe beleidigt abreiste. Anschließend wollte er aus Prinzip Stutzi den Hintern versohlen, doch sie gab ihm einen Tritt in den Bauch und sprang aus dem Fenster.
Bis zu ihrem elften Lebensjahr trug Stutzi Lederhosen. Speckige, krachende Lederhosen. Sie trug si e daheim, im Kino und in der Schule. Ihre Lehrerinnen bombardierten deswegen Vater mit Fleh- und Drohbriefen. Er schoss scharf zurück. Auf gehämmertem Büttenpapier verbat er sich jede Einmischung. Stutzi galt dann als bedauernswertes Geschöpf eines spleenigen Vaters.
Bei der Auswahl unserer Eltern sind wir wirklich etwas leichtsinnig gewesen. Ich hatte den Vortritt, konnte aber nicht viel damit anfangen. Nach fast vier, meist verschlafenen, Jahren bekam ich Stutzi dazu. Zwar wäre mir eine Eisenbahn zum Aufziehen lieber gewesen, aber auch meine Schwester hatte viele Hebel und Schalter zum Drücken und Biegen - die Enttäuschung hielt sich daher in Grenzen.
Dass wir seit ihrem Auftauchen keine Mama mehr hatten, fiel mir erst später auf. Dunkel erinnere ich mich noch an allerhand langhaarige, junge Frauen, die mich in den folgenden Jahren zum Essen zwangen, mir den Mund abwischten, mich ins Bett schickten, das Licht löschten und mir auch sonst das Leben vermiesten.
Ich war gerade zwölf und Stutzi acht, als Vater eine Militärdiktatur einführte: Er, der Große Fritz, übernahm den Oberbefehl und ernannte eine ältere Dame, unsere Haushälterin, zum Hauptmann. Sie hatte mir zu befehlen. Ich wiederum, als Unteroffizier, durfte Stutzi Befehle erteilen, die es nur bis zum Obergefreiten gebracht hatte. Stutzi schrie Zeter und Mordio: Leutnant war das mindeste, was
sie sein wollte. Also wurden wir alle befördert, Stutzi zum Leutnant, ich zum Oberleutnant, und alle waren zufrieden. Unser Staatswesen funktionierte. Bis plötzlich eines Tages mein Untergebener nicht mehr mitspielte.
Stutzi muss so um die dreizehn gewesen sein, als sie überschnappte. Sie verweigerte den Gehorsam, setzte sich stundenlang vor den Spiegel, brannte sich mit einer glühenden Schere Wirrwarr ins Haar, putzte sich die Ränder unter den Fingernägeln weg und trug Kleider. Täglich weinte sie zwei Stunden, weigerte sich, weiterhin mit mir in einem Zimmer zu schlafen, verlangte – und bekam sogar – ein eigenes, und ging mit mir um, als wäre ich etwas Unanständiges, Ekelhaftes. Sie kreischte wie am Spieß, wenn ich mal ins Bad kam, und ließ sich von mir nicht mehr den Rücken waschen.
Anfangs übersah ich das blöde Getue, aber mit der Zeit nervte es mich doch. Erstens war ich neugierig, und zweitens immerhin schon siebzehn und ein Mann! Es war unter meiner Würde, mich mit einer Verrückten herumzuärgern.
Bei einer Offiziersbesprechung informierte ich den Oberbefehlshaber. Vater malmte mit den Zähnen und gab mir den dienstlichen Befehl, mich ausgehfertig zu machen. Ich weiß es noch genau, es war ein brütend heißer Nachmittag. Er führte mich in eine Café bar und bot mir eine Zigarette an.
Donnerwetter! Er erzählte von Mama und redete volle zwei Stunden. Nicht von Bienen un d Störchen, dafür war ich mindestens sieben Ja hre zu alt, aber von Mädchen und Frauen, von Wachstum und Zyklus, von Eierstöcken und Gebärmutter.
Guter Himmel, wie ich versuchte, die manchmal aufkommende Verlegenheit zu unterdrücken! Zum Schluss dankte ich dem lieben Gott, der mich damit verschont hatte, ein Mädchen zu sein. Seit damals weiß ich, was für furchtbar vertrackte Wesen Frauen sind.
Jedenfalls versuchte ich in nächster Zeit, kein Sand in Stutzis kompliziertem Getriebe zu sein. Mein guter Vorsatz wurde arg strapaziert. Monatelang dominierten ihre meist tränenreichen Launen, und Woche für Woche opferte ich die Hälfte meines Taschengeldes, um sie zu bestechen. Ich brachte Dauerlutscher, Fahrradwimpel, Abziehbilder und sogar eine Mundharmonika. Meistens feuerte sie
mir die Geschenke an den Kopf. Vater empfahl mir Alternativen. Anstatt Zuckerzeug versuchte ich es nun mit einem großen Kamm, mit blinkenden Ohrringen, mit einer Puderdose. Siehe da, sie nahm es an, ihre umflorten Augen billigten mir mildernde Umstände zu.
Doch langsam kapierte auch ich, dass ich ein richtiges Mädchen zur Schwester hatte. Da sie sich nicht beeilte, nach oben zu wachsen, wuchs sie eben nach vorne. Dort, eine gute Handbreite unter dem Hals, legte sie Depots für schlechte Zeiten an. Der Leutnant hatte seinen Wehrdienst beendet. Außerdem meinten meine Kameraden, dass Stutzi ein niedlicher Teenager sei. Als ich es oft genug hörte, glaubte ich es selbst.
In einem Anfall von Leichtsinn nahm ich bei Vater einen größeren Kredit auf und kaufte ihr einen Hund. Ein schwarzes, wolliges Knäuel, das nur aus Zunge, Pfoten und Fell bestand. Ich konnte nicht ahnen, was ich damit anstellt e! Als erstes bekam ich einen Kuss. Den ersten nach vielen Monaten. Dann nahm sie das schwarze Etwas, und alles war harmonische Wonne. Ihre ganze Zeit widmete sie dem Hund.
Unter ihren streichelnden, kosenden, fütternden Händen schnurrte und brummte der Welpe von früh bis spät, mal laut, mal leise, mal melodisch sonor, plötzlich erschreckt quietschend. Wir nannten ihn Brummerle, eigentlich logisch, und später dann Brummer.
Er revanchierte sich bald.
Ein halbes Jahr später starb Vater. Für uns beide brach eine Welt zusammen, aber Stutzi fiel bodenlos. Sie verfiel der Melancholie und dem In-die-Luft-starren. So oft ich auch mit ihr redete – sie schaute durch mich hindurch. Ich hatte richtig Angst, wusste nicht mehr, wie ich sie aus dieser Lethargie lösen konnte. Dann kam Brummer und nahm mir diese Sorge ab. Mit sagenhafter Ausdauer und Sturheit stupste er Stutzi an, brummte die Tonleiter rauf und runter und lief zwischen ihren Füßen herum. Er wog schon dreißig Kilo und hielt viel von Bewegung. Stundenlang zog er meine Schwester an der Leine hinter sich her, wirbelte mit einem Schulterstoß andere Hunde durch den Straßenstaub und zögerte auch nicht, mit Stutzi zu raufen. Zwar kam die Lederhose nicht mehr zu Ehren, dafür Jeans. Bald hingen in ihrem Schrank mehr Hosen als Röcke. Sie lebte wieder.
Dann kam Tante Agathe mit Koffern und Familiensinn.
Stutzi magerte ab, und Brummer bekam den bösen Blick. Als Tante Agathe uns wissen ließ, sie werde für Stutzi die Vormundschaft beantragen, gab ich ihr Hausverbot.
Sie konnte es nicht fassen! Ein Bengel von gerade achtzehn schmiss sie aus dem Haus ihres Bruders! Ihre Rache spürten wir postwendend. Beamte kamen und beschmutzten unsere Teppiche. Nachlass- und Vormundschaftsgericht, Jugendamt, Sterbe- und Waisenkasse, Versicherungen – alle schickten uns neugierige Personen ins Haus, die dämlich fragten, indiskret die Einrichtung musterten und wissen wollten, wie es uns denn so gehe!
Tante Agathe ließ nicht locker, wollte Stutzi unbedingt bei sich haben. Doch so schnell lässt ein Münchner Gericht nicht zu, dass ein Bayer nördlich des Mains verschleppt wird. Die Schule gab den Ausschlag. Stutzi pochte darauf, in ihrer Schule zu bleiben und ließ an unserer Tante kein gutes Haar. Ich redete mit Händen und Füßen, es sei unmenschlich, Geschwister auseinander zu reißen,
grundlos, eigentlich nur, weil eine alte Frau Langweile habe.
Da ich schon achtzehn war, gab es einen Kompromiss: Ein Amtspfleger wurde bestellt, dessen Namen wir heute gar nicht mehr wissen. Dieser Sieg brachte uns ein gehöriges Stück näher. Ab diesem Moment rückten wir enger zusammen.
Gemeinsam hatten wir etwas erreicht.
Als Stutzi ihr Abschlusszeugnis bekam, versuchte sie es mit Arbeit. Nach einigen erfolglosen Experimenten vernagelten wir Türen und Fenster und brachten Koffer und Hund zum Bahnhof. Über ein Jahr lang durchstreiften w ir die deutschen Großstädte: Köln, Hamburg, Frankfurt. Es war eine irrwitzige Zeit! Man konnte Stutzi nicht alleinlassen! Sie legte sich mit allem und jedem an. Erst, als wir
zusammen im gleichen Betrieb arbeiteten, herrschte Ruhe.
Der eigentlich Leidtragende in dieser Zeit war Brummer. Personal braucht sehr wenig Wohnraum. Unsere Unterkünfte maßen drei mal drei, bestens vier mal vier Meter. Wenn Brummer sich einmal umdrehte, flog das Tischchen um, wenn er sich bei Regenwetter einmal schüttelte, hatten die Tapeten neue Muster.
Schmutzwäsche wurde unter die Stockbetten geschoben, Brot oder Wurst schimmelte nach einem Tag. Wir wechselten den Job, sobald der Dreck überhand nahm.
Mit der Zeit gewöhnten wir uns an das Nomadendasein, waren nirgends lange genug, um aufzufallen, und verdienten Geld. Nicht genug, um davon leben zu können, wir mussten jeden Monat von unserem kleinen Erbe dazulegen, aber es waren eben Lehr- und nicht Herrenjahre.
Stutzi hat bis heute keinen eigentlichen Beruf. Es stört sie bisher nicht, und sie ist jung genug, um das nachzuholen, sollte es mal wichtig für sie sein. Das Geld dafür ist angelegt, unsere Bank verwaltet diese Wertpapiere.
Stutzis achtzehnten Geburtstag feierten wir ziemlich schwankend im Schlafwagen zwischen Köln und München. Um zwölf krabbelte sie die Leiter zu meiner Koje herab, öffnete eine Flasche Champagner und seufzte herzerweichend. Wir waren endgültig auf dem Heimweg.
Das Haus verkauften wir - es brachte trotz Hypothek noch einen Batzen Geld - und zogen in eine kleine versteckte Villa am Rande Münchens. Ein großer Park mit Bäumen, Büschen und Hecken umgibt unsere Bleibe.
Um das Bild gerade zu rücken: Eigentlich haben wir nur zwei Zimmer: ein gemeinsames Schlafzimmer und ein übergroßes Wohnzimmer. Eingerichtet haben wir uns a la Pariser Mansarde, mit vielen kleinen Teppichen, wenigen, aber noblen Möbelstücken, mit Büchern, Schallplatten und CDs, und natürlich immer unaufgeräumt. Unten im Keller gibt es noch eine Rumpelkammer, vollgestopft mit Möbeln aus unserem Elternhaus. Ein Chaos, aber bequem genug, um ab und zuflüchten zu können. Auch ein paar Flaschen Wein lagern hier. Für diese Bleibe plus Hundehütte bezahlen wir neunhundert Mark. Über uns wohn t nur noch der Besitzer, und der hat außerdem eine Penthauswohnung in der City. Wir sehen ihn vier-, fünfmal im Jahr.
Unser Geld für diesen Luxus verdienen wir zur Zeit im Eve, einem der bekannteren Nachtclubs Münchens. Wenn ich unseren Background so überdenke – eigentlich nichts Besonders.
Es regnet noch immer. Blöd-grau starrt der Tag i ns Zimmer. Brummer wäscht mir das Gesicht. Ich gebe ihm eine Ohrfeige.
„Winnetou?“
Diesen Ton kenne ich. Moll. Cis M oll. Einschmeichelnd. Ich höre, wie sie aus dem Bett steigt, sich auf meine Daunen setzt.
„Schau doch mal aus dem Fenster. Es ist trostlos. Es regnet. Wie gestern, wie vorgestern, wie vorige Woche. Das Barometer schämt sich, und ich bekomme eine Gänsehaut.“
Es klingt, als stelle sie mich unter Anklage. Ihre teakholzbraune Windstoßfrisur umrahmt das noch leicht verschlafene, schmollende Gesicht. Der zerknitterte Pyjama hängt formlos an ihrem Körper. Winnetou sagt sie immer dann, wenn sie was will. Ich weiß es, sie weiß es. Brummer reibt sich an ihren Beinen. Er weiß es auch.
Ihre schmalen Finger spazieren über mein Gesicht.
„Ich meine“, plappert sie weiter, „wir sollten die Initiative ergreifen. Wenn die Sonne nicht zu uns kommt – gut, dann müssen wir eben zu ihr. Schau her , ich bin schon ganz blass.“
Sie zieht die Jacke ihres Pyjamas über die Schulter.
Ich tue so, als sei ich nicht neugierig. „Setz dich vor die Höhensonne“, rate ich ihr.
Sie zieht einen Flunsch. „Unter einer Höhensonne kann man nicht segeln.“
„Und wie willst du nach Riva kommen? Wovon willst du leben?“
Ich frage, obwohl ich die Antwort kenne. Viele Sommer am Gardesee liegen hinter uns, und zwei davon, wie man sie nur aus Werbefilmen kennt. Zwei Sommer, vollgepackt mit Sonne, Wind, türkisblauem See und mit unendlichem Wohlbehagen.
Sie wird ganz aufgeregt: „Oh, du, pass auf! Ich sorge für Fahrgelegenheit, bestimmt! Und du ziehst wieder jemanden aus dem Wasser. Das hat letztes Mal auch geklappt!“
Ihre Logik hat etwas für sich. Ein Wimpel an unserem Boot, der Luckystar, bezeugt: Wir haben jemanden aus den Wellen des Gardasees gefischt! Der fast Ertrunkene schätzte sein bisschen Leben hoch ein und opferte. Die Opfergaben reichten aus, um uns ein Vierteljahr Urlaub zu finanzieren. Wenn Stutzi also auf das Gesetz der Serie spekuliert, dann tut sie es nicht ganz zu unrecht. Trotzdem bin ich nicht begeistert. Gabi würde mich fragen, ob ich total spinne. Ich k ann wirklich nicht für Wochen verschwinden - gerade jetzt, wo das Eis zwischen uns schmilzt. Und gut bei Kasse sind wir auch nicht. Was, wenn niemand uns den Gefallen tut und ersäuft?
„Bitte, Winnetou, bitte.“
Aussichtslos! Dagegen komme ich nicht an. Ich weiß es, wir wissen es beide.
„Ich finde schon einen, der uns mitnimmt. Bestimmt!“
Diese Masche von ihr kenne ich auch. Genaueres will ich gar nicht wissen. Morgen, spätestens übermorgen jedenfalls wird einer sie abholen, große Augen machen, weil Brummer und ich auch einsteigen und sich zu sehr schämen, um uns wieder aus dem Auto zu werfen.
„Also gut.“
Sie vibriert vor Energie und Aufregung, vergessen sind Regen, Kühle, Schnupfen.
Stutzi wirbelt durchs Zimmer, sucht Koffer, fängt an zu packen.
Brummer macht mit dem Unsinn Schluss. Mit einem zärtlichen Schlag wirft er sie zu Boden und wäscht sie gründlich . Stutzi quietscht in den höchsten Tönen, klammert sich an ihm fest. Stück für Stück schleift er sie zur Tür. Brummer weiß nicht, was ein Pyjama ist, er würde meine halbnackte Schwester glatt ins Freie schleppen.
Wir schlüpfen in die Trainingsanzüge. Dann kommt Brummer auf seine Kosten. Wie Verrückte hüpfen wir durch den Park, raufen mit dem Hund, strapazieren seine und unsere Muskeln. Ein tägliches Spiel.
Der Regen weicht uns auf. Stutzi reitet auf dem Hund ins Haus. Zwanzig Minuten braucht sie sicher, um ihn zu trocknen. Ich gehe inzwischen zum Metzger und hole sein Frühstück. Außer Dosenfutter, vermischt mit Hackfleisch, kriegt Brummer jeden Tag Kalbsknochen.
Während Brummer frisst, kultiviere ich mich. Unsere Dusche hat Pfiff. Sie lässt nicht nur von oben Wasser fallen, nein, es spritzt aus noch acht Düsen in jeder Höhe. Obendrein kann man jede Düse einzeln temperieren. Der totale Luxus!
„Du, Stutzi!“, rufe ich durch die Duschverglasung, „fährst du noch mit Brummer in die Tierklinik? Er muss noch geimpft werden.“
„Klar.“
Nanu, das ging aber schnell! Solche Wege versucht sie eigentlich immer mir anzuhängen. Richtig, einmal hat sie kurz einen Tierarzt erwähnt.
Ich drehe das Wasser ab. „Du sollst wegen Brummer zum Tierarzt . Oder hast du ihn auch nötig?“
„Noch einen Ton, und mich befällt die Tollwut!“
Während Stutzi sich anzieht, spendiere ich weitere Knochen. Eine Wonne zuzuschauen, wie sie zwischen Brummers Zähnen verschwinden. Ich spüre, wie mein Magen knurrt
Da kommt sie. Frech, charmant, lieb, sehenswert verpackt in einem rehbraunen Lederkostüm. Ein Hauch Kölnisch Wasser weht um sie. Sie drückt mir einen Zettel in die Hand: „ Schuhe von der Reparatur holen. Wäsche aus der Reinigung. Einmal parfümierte Taschentücher, einmal mit Menthol. Ein Paar Strümpfe nicht vergessen. Marke Gazelle.“
Endlich sitzen wir im Café, gleich neben unserer Wohnung.
Es ist vier, unsere Frühstückszeit.Stutzi futtert Apfelstrudel, dazu Kaffee und Orangensaft, ich genieße Croissant mit Butter und Marmelade. Dann die erste Zigarette. Tief ziehe ich den Rauch in
die Lungen; das leichte Benebeltsein ist herrlich, entspannt.
„Na, na“, beschwert sie sich, „Manieren wirst du wohl nie lernen. Man gähnt eine Dame am Tisch nicht an.“
„Schwestern sind keine Damen.“
„Was dann?“
„Nervtötende und kostspielige kleine Luder.“
„Dein letztes Wort?“
„Meine tiefste Überzeugung!“
Sie steht auf, beugt sich zu mir, haucht mir einen Kuss auf die Wange. „Dann will ich dir nicht zumuten, mit einem Luder im gleichen Taxi zu sitzen. Servus.“
Sie nimmt die Leine und geht zu r Tür. Ich wette mit mir selbst um einen Cognac gegen einen Armagnac: Wetten, gleich kommt sie zurück, weil sie was vergessen
hat!
Helmut, der Besitzer des Cafés, setzt sich zu mir. „Ist sie wirklich deine Schwester? Ich glaub’s einfach nicht.“
„Beschwören kann ich es nicht.“
Er sieht versonnen zum Eingang. „Wie groß ist sie eigentlich? Ich glaube, in meiner Manteltasche hätte sie bequem Platz."
„Fast. Immerhin Einsfünfzig, umwickelt mit achtundvierzig Kilo zartrosa Spanferkelspeck.“
„Mein Gott! Das nennt man Perlen vor die Säue werfen! Ich könnte heulen.“
„Erzähle es ihr, nicht mir. Auf diesem Ohr bin ich taub.“
Er starrt noch immer zum Eingang. „Deine Schwester hat so was an sich... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sobald ich sie sehe, möchte ich Schild und Schwert holen und sie beschützen. Diese winzige Niedlichkeit kramt die letzten Reste von edlen Instinkten hervor. Man kommt sich so stark vor.“
Ich lasse ihm seine Illusion. Stark kommt er sich vor. Dass ich nicht lache! Weich und wabbelig würde er in ihren Händen werden. Außerdem gewinne ich gerade einen Cognac, denn atemlos trippelt sie auf mich zu. „Ich habe was vergessen. Schau doch bitte bei der Bank vorbei und frage nach meinem Kontostand. Hier ist die Kontonummer. Holst du mich beim Friseur ab? Um acht bin ich fertig. Bitte.“
„Schon gut, aber die Klinik macht bald zu.“
Ein Schmunzeln huscht um ihre Lippen: „Für mich nicht“, und weg ist sie.
„Bring mir einen Cognac, Helmut, hab ihn eben gewonnen.“
„Gewonnen? Von wem?“
„Von mir.“
„Und wenn du verloren hättest?“
„Dann dürfte ich einen Armagnac trinken.“
„Spinnern widerspreche ich nicht.“ …